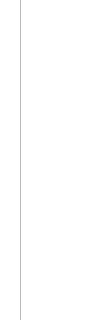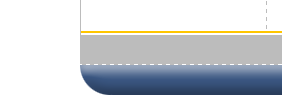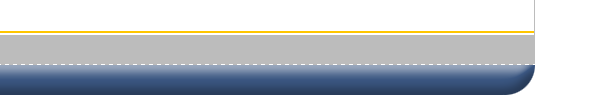Reden wir einmal ganz allgemein
davon, dass es da ein Maß geben muss, welches uns signalisiert, ob unsere
Identifikation von etwas zuviel der Identifikation ist oder zuwenig davon.
Nennen wir es provisorisch Lebensmaß. Klarerweise setzt dieses Lebensmaß immer auf
schöpfungshafte Signalität auf. Etwas als etwas zu identifizieren, kann
leichter fallen und näher liegen, oder es kann eine immense identifikative
Aufwendung erfordern. Was von beiden der Fall ist, wird von der Stofflichkeit
des Anvisierten entscheidend mitbestimmt. So ist etwa die Farbe Rot naturgemäß
eine offensive Signalfarbe, und es legt sich mir entsprechend eine rasche
Idenfikation des Signalisierten ‚als signalisiert’ nahe. Ein innerkörperliches
Signal wie akuter Schmerz ist auch nicht auf lange Umwege in seiner Wahrnehmung
ausgelegt; die Identifikation hierbei zu verzögern wäre ungewöhnlich, sagen wir
durchaus (auf vorkonkreter Ebene) erklärungsbedürftig. Die Korrelation von
stofflicher Signalität mit seelischer Repräsentanz reicht dabei von einfachen
Affekten bis zu ausdifferenzierten Motivationslagen, von kräftigen Bildern, nah
an der sinnenhaften Abnahme, bis zu dem brüchigen oder sich schon
verflüchtigenden Bildhintergrund bei abstrakten Reflexionen.
Unser Lebensmaß ist ein 'automatisch mitlaufender' Gradmesser der mit dem aktuellen Identifizieren gegebenen Vitalität - jene allerdings nur im Sinne einer Basis-Vitalität, nicht als eine final zu bewertende Lebenstüchtigkeit; in solch finale, ganzheitliche Bewertung spielt es freilich konstitutiv hinein. Es ist also in dieser basisvitalen Weise eine Konstante, an
der sich unsere identifikativen Erschließungen und Einschätzungen bemessen -
nach der Verhältnismäßigkeit des geleisteten identifikativen Inputs ‑ und
so erst konstituieren. Unsere Identifikationen werden an diesen Punkt der
Abgleichung am Lebensmaß gebracht bzw. schließen ihn schon ein.
Identitätshaft treibende
Charakteristik allerdings, im Sinne eines zumindest ansatzweisen
Identität-haben-Wollens, verleiht das Lebensmaß gerade indem wir es (sehr oft
auch schon begründet durch die laufende Notwendigkeit lebensweltlicher Jetzt-Entscheidungen) verfehlen. Es sind
dann tatsächlich die Abweichungen vom Lebensmaß, die vordringlich erinnerbar
sind. Generelle Erinnerbarkeit im Wesensvollzug gibt es freilich nicht erst bei
starken Ausschlägen oder etwa offenkundiger Leidenschaft, sondern in feinsten
Abstufungen, in einem unwillkürlich stattfindenen Summieren unseres identifikativen
Inputs in den Entscheidungscharakateristiken.
Daraus ergibt sich
eine legitime Unschärfe im Selbstgegenübersein, konkret in der Kunst, noch
konkreter in der Politik. Im Effekt reden wir eigentlich von einer legitim
vollzogenen Schärfe, genauer: Scharfstellung, bei der Überführung von
innerlicher seelischer Gestaltlichkeit in äußerlicher seelische (wir nennen es
konkretheitliche) Repräsentation, was eine Ungenauigkeit der Entsprechung zur
Folge hat, welche also ‚in Kauf genommen’ werden kann. Dies darf gleichwohl nie
dazu führen, unsere Ausrichtung auf Idealität erklärtermaßen abzuschwächen. Jede konkrete Bezugnahme auf das
Lebensmaß, erst recht durch solche pragmatische Relativierung, wäre im Kern
totalitär. Und die legitime Abschwächung bzw. Übersteigerung unseres Anstrebens
von Idealität geschieht ja ohnehin ‚von selber’, in der Dynamik des Lebens.
Das Lebensmaß und
seine legitime Verfehlung entziehen sich jeder wissenschaftlichen Beschlagnahmung.
Eine solche wurde und wird freilich trotzdem versucht, unter variierenden
Terminologien, aber fast immer mit einer hoffnungslos verdünnten Semantik der
eingesetzten Begriffe und mit dem Ergebnis wenig ersprießlicher Darstellungen
des Subjekthaften. Kommunikationswissenschaft, Ideologiekritik, Demokratietheorie
bis hin zur Fundamentalontologie agieren mit psychologischen, soziologischen oder
politologischen Figuren und Fertigbegriffen, welche zuviel terminologisch
Vorentscheidungshaftes einbringen und so die Aufspürung eines Lebensmaßes
(vielleicht formuliert als glückliche Richtigkeit, geistesgegenwärtige
Zusammenschau o. ä.) von vorneherein nicht zustande bringen. Das wurde und wird
auch eingestanden, zumeist allerdings nicht mit der Folge einer bescheidenen
Selbstzurücknahme - „Das menschliche Subjekt mit seiner subjekthaften
Angefordertheit kann von Wissenschaft nicht mehr authentisch beschrieben werden“ ‑,
sondern die Grenzen der wissenschaftlichen Erschließung bestimmen dann unter
der Hand die Grenzen des zu Erschließenden.
Viel akute oder
verkappte Ideologie schwingt hier auch mit. Wenn etwa der neomarxistische
Philosoph Louis Althusser einer Subjektkonstitutivität von Ideologemen das Wort
redet – in verfeinernder Kontinuität zur marxenschen Selbstkonstitutivität in
klassengeprägter Daseinsrealisation ‑, ist damit eine massive Politisierung in
das Innerste des Subjekts hineinverlegt. Im real existierenden Sozialismus der
letzten Jahrzehnte kämpfte man ja ausdrücklich gegen Totalitarismen, auch im
Sinne einer Läuterung seiner selbst, aber führte den Diskurs stets innerhalb
der eigenen Nomenklatur, mehr oder weniger streng entlang der historischen
Vorgabe, dass gemäß den Produktionsverhältnissen Bewusstsein gebildet werde.
Das verquickte sich dann insbesondere mit der Psychoanalyse Freuds und prägte
so eine psychologisch-politische Intellektualität weltweit. Und das menschliche
Subjekt verlor bei tonangebenden Philosophen schließlich jede substanzielle
Eigenrealität und wurde etwa als ‚Strukturelle Unmöglichkeit‘ ausgewiesen, die
alte Frage nach dem Subjekt dabei so gewendet, dass die Unmöglichkeit einer
gänzlichen Selbsterschließung des Subjekts für das Subjekt genau das Subjekt
ausmache – nur eben nicht in dem Sinne, dass da noch etwas (Unerschließbares
Tieferes) substanziell gegeben sei, sondern unser Subjekt-Sein sei positiv
dieses Unvermögen und das Subjekt positiv das entsprechende Nichtseiende.
Da wird mit einem
so kecken wie schludrigen Schritt, der seine erkenntnistheoretische
Abgründigkeit nicht durchschaut, der Spieß umgedreht und aus der
Nichtbeschreibbarkeit des Subjekts die Beschreibbarkeit des Subjektnichts. Eine
lange Vorgeschichte von denkerischen Plastifikationen abstrakter Gehalte, denen
keine originär anschaubare oder erlebbare Gegenwertigkeit mehr entspricht, hat
solchem Denken-in-Sprache zu seinen Ergebnissen verholfen. Diese
Plastifikationen stellen Überidentifikation dar, und zu forsch auf sie
aufzusetzen heißt identitätstechnisch, dass jemand in einem fertigsprachlichen
Abgreifdenken unterwegs ist. Das Lebensmaß, als der fertigen Identifikation und
dem sprachlich fertig Identifizierten und Präsentierten vorausliegend, ja den
Weg bis zu einer jeweils findbaren Sprachlichkeit identifikationsvorbehaltlich
‚störend’, ist hier von einer dynamisierten Eigenmacht des Terminologischen
überdeckt. Das trifft gerade auf Strukturalismus und Poststrukturalismus fast
in Gänze zu: Man bricht zwar unsere Erkenntnisgeflechte auf kleinstmögliche
Einheiten herunter, setzt aber mit dem Vorgang
solcher Dekonstruktion eine umso größere Einheit, nämlich ein hochgradig
identitätswirksames Vorzeichen, wie man sich mit Letztgültigkeit auseinanderzusetzen
habe.
Signifikat (ein zu Bezeichnendes)
und Signifikant (das materiell Bezeichnende) ließen sich nicht voneinander
trennen, ohne auf eine notwendig ideologische Metaebene zu rekurrieren, also
werden sie möglichst in eins gesetzt. Manche Vertreter der Sprachphilosophie,
wie die amerikanische Gender-Philosophin Judith Butler, setzten unser
Verfasstsein in einem tradierten Sprach- und Kulturzusammenhang gleich als ein
absolutes voraus, soweit, dass gelebte Sprache gar unser unhintergehbares Begreifen von Körperlichkeit (etwa die Geschlechtszugehörigkeit eines Menschen) erst bewirke.
Hier hat sich dann ganz eindeutig etwas plastifiziert, aber nicht
Geschlechtszugehörigkeiten, sondern die Denkinstrumente einer Ideologin, die
einer Ideologiekritik im eigentlichen Sinne auch nicht mehr zugerechnet werden
kann. All diesen ideologiekritischen Ansätzen gemeinsam aber ist eine
vertrackte Methodisierung, Hypostasierung oder mindestens sprachliche Fixierung
von Gewährleistungspunkten. Etwas wird immer als Anker für Richtigkeit installiert,
genauer als Aufweis für wissenschaftliche Besprechbarkeit.
Im Zuge der
Aufarbeitung des 68er-Phänomens gerät die Frage nach Ideologie als solcher –
gemäß unserer Terminologie: eine offensive Verfehlung des Lebensmaßes – auch
immer wieder in einen breiteren Fokus. Auf allen Kanälen wird dann eine Zeit,
die sich ihrerseits schon über ambitioniertes Analysieren definierte,
populäranalytisch beleuchtet. Aber damals wie heute realisiert man dabei kaum,
dass die angewandte Analytik nicht in den Kern einer Sache reichen kann. Schon
die ‚Dialektik der Aufklärung’ von Horkheimer und Adorno lief letztlich auf
eine technisierte Darstellung ihres Gegenstandes, also des selbstentfremdend
subjekt-technischen Denkens der Moderne, hinaus, und das seelische Herkommen
alles Denkens und Begriffsbildens wurde zwar tief aber nicht tief genug
thematisiert. Gleiches gilt erst recht für den zeitgenössischen
Existenzialismus. Er hat eine allzu eloquente Positivierung unserer
‚Existenzialien’, schließlich des gesamten menschlichen Daseins entwickelt. Und
mehrere Generationen von Intellektuellen trugen und tragen solche
menschenkundliche Versiertheit wie einen Katalysator ihres Denkens mit sich
herum. Auch heute werden Begriffe wie totalitär und intolerant fast traumwandlerisch
routiniert gebraucht, durchaus auch in selbstkritischer Stoßrichtung, aber
dabei nicht in der nötigen Tiefe geführt.
Sie sind von
vorneherein gesellschaftstheoretisch eingepackt und auf mediale Wirkung hin
verinnerlicht, was real bedeutet mit Selbstbespiegelung und massiven
identitätshaften Dynamisierungen versetzt. So geht es vielleicht am
auffälligsten in den TV-Talkrunden, aber ohne dass es die Beteiligten wirklich
realisieren würden, permanent um Selbstdarstellung und intellektuell
aufgeblasene Selbstbeheimatung. In authentischer Tiefe sollte es um
Ideologisierung als solche gehen, und diese beschreibt ein geistiges Naturell,
aber grundlegend, nicht von vorneherein mit Begriffen wie faschistoid etc.
politisiert und dynamisierend überdeckt. Also, ein Naturell der geistigen
Erschließung, das sich in verschiedensten (z. B. politischen) Gestalten
manifestieren kann und folgender Art ist: Die Gehalte sind zweitrangig, eine
getriebene Vehemenz in der Identifikationsnatur bestimmt das Denken.
(Jenes ‚Eifern nach
Identität’, welches von Adorno schon machtpartizipativ, also in psychologischer
und soziologischer Figuration gedacht wurde, ist damit nicht deckungsgleich,
sondern stellt eher schon einen Spezialfall dar. Das Phänomen
Überidentifikation in seiner ersten Tiefe könnte nur in phänomenologischer
Nahbetrachtung, einer Art Selbstversuch von unerbittlicher Eigenbetrachtung
‚beim’ Identifizieren aufgespürt werden. Solches führt natürlich sofort in
tiefgreifende Interferenzen und Turbulenzen, weil damit – real wirksam -
jegliche Identitätseffekte zur Disposition stehen, auch jene, die sich bei der
kritischen Absetzung selber ergeben.)
Bei seinen
Identitätsanknüpfungen von Vorlieben bestimmt zu sein, also im Tieferen eine
Fortführung des Selbstbildes anzustreben, ist grundmenschlich und ein zunächst
noch unverdächtiges Konstitutivum aller Kultur. Falls aber das vorherrschende
Identifikationsnaturell eine rigorose Überidentifikation darstellt, ist aus
Vorliebe zwanghafte Leidenschaft geworden. Als typisches Beispiel hierzu mag
Gudrun Ensslin angeführt sein, die fast nahtlos von einem aktivistischen
Protestantismus zu einer aktivistischen, recht bald terroristischen
Gesellschaftsveränderung strebte, zuletzt ging es nur noch um: Aktion.
Natürlich sind die Beispiele unübersehbar zahlreich, der Linksanwalt wurde zum
Rechtspopulisten, die eifernd tugendsame Klosterschülerin avancierte zur
rigorosen Feministin mit der reinen Lehre, der verkannte Künstler stilisierte
sich zum Gesamtkunstwerk auf der politischen Bühne. Was hier so trocken
nebeneinander gestellt ist, hat eine (sich jeweilig dynamisierende) Kontinuität
im Identitätsnaturell gemeinsam. Auch ganze Milieus können die Vorzeichen
wechseln, Zeitstimmungen die Affekte konträr entgegengesetzter Zeitstimmungen
verkappt in sich abbilden.
Was die
Umbruchstimmung anno ´68 betrifft, wurde von Jürgen Habermas sehr zeitnah,
schon in der Hitze der ersten Konfrontation, von Linksfaschismus gesprochen.
Ähnliches hörte man zunehmend von Leuten aus den aktiven Zirkeln selbst. Götz
Aly hat in unseren Tagen dann ausdrückliche Parallelen gezogen zwischen der
33er- und der 68er-Jugend. Analogien unter diesem Fokus bieten sich natürlich
an, weil hier eine Jugend angetreten war, den Faschismus der Vätergeneration zu
überwinden, aber sie sind in sich, also ihrer Methodik nach, ausgesprochen
problematisch. Das zugrundeliegende tiefere Problem kann, wenig zielführend,
mit solchen Zuschreibungen auch historisiert werden. Echte Kommunikations- und
Extremismusforschung wird sich hüten, Totalitarismen vorschnell in
zeitgeschichtliche Raster zu packen. Sie sind eben auch: geschichtlich
jeweilige Manifestationen einer tieferen, sozusagen übergeschichtlichen
Konstante, nämlich des menschlichen Sündenfalls, sich des Lebens und der
Wahrheit bemächtigen zu wollen.
Totalitarismen
zeichnen sich dadurch aus, dass eine heischende Totalität der Identifikation
alles richten soll. Diskurse sollen, unterschwellig aber unerbittlich, durch
einen leidenschaftlichen Gestus entscheidbar sein. Dieser Gestus wiederum meint
eine (wie auch immer sich konkret ausprägende) Selbstgenüsslichkeit darin wie ich zu identifizieren beliebe, also
auf welchen Daseinsansatz ich mich immer wieder rigoros zurückziehe, wie ich
rigoros da-sein will. Wir haben es
dabei mit einem so zeitlosen wie breitesten Phänomen zu tun. Offenkundig trifft
es heute z. B. für poppig-peppige Zeitgeistmedien zu, verdeckter für säuerlich
bürgerliche Zeitungskolummnen. Die genüssliche Egozentrik tendenziösen
Auffassens haben wir bei der flink spitzen Intellektualität in manchen
Studentenkreisen wie bei dem – jetzt ein Sprung, der aber identitätstechnisch
gar nicht so groß sein muss – abgebrühtest ruhigen Gewissen der islamistischen
Massenmörder.
Eine
identitätshafte Selbstbeheimatung über Gebühr, Überidentifikation, ist hier
also das gemeinsame Problem. Es kann die akut gefährliche Gestalt eines Affekts
‚gegen die Bösen’ einnehmen, es kann aber auch eine längerfristig, vielleicht
erst nach Generationen wirksame Gestalt von hemmungsloser wie hilfloser Egozentrik
annehmen. Und niemand sollte etwa so naiv sein zu glauben, dass die
gegenwärtige Schlagseite in unserer Mediengesellschaft, ein immer allgemeinerer
und härterer werdender Selbstdarstellungszwang, ohne Folgen bliebe.
Sein durch Schein. Das Identitätshafte
ist entsprechend längst einer Professionalisierung unterworfen, aber nicht in
dem selben Maß einer Authentisierung, eher im Gegenteil. In Castingshows wird
beklemmend deutlich, dass sich zwar alle bemühen, inbrünstig und authentisch zu
sein, dieses aber verwechseln mit hemmungsloser Identitätstotalität. De facto
hat man sich dabei gesellschaftlich favorisierten Rollenbildern unterworfen.
Wenn es in meiner erworbenen Identität nicht vorkommt, einmal für keinen etwas
gewesen zu sein, dieses auszuhalten, mich nach höherer Sinngebung
auszustrecken, die nicht in gesellschaftlichen Images untergebracht ist, wenn
also mein Selbstvollzug immer festgemacht war an Vorentscheidungen, wie ich auf
Erwartungen zu reagieren habe – stehe ich in subtiler doch dramatisch
umfänglicher Versklavung. Ein kaum greifbares aber tiefes Leiden von
allergrößter Verbreitung gerade im westlichen Kulturkreis. Damit sind nicht die
klassischen Selbstfindungsnotoriker gemeint (diese Generation ist auch gerade
am Abtreten), sondern der klassische Normalo 2009, wie er sich auf eine Kultur
verwiesen findet, die ihn nicht mehr beheimaten kann aber ihn desto offensiver
beheimaten will. Und da hängt er drin. Sein Selbstvollzug erspart sich die
Letzt-Dringlichkeit, wobei er eine mangelnde Authentizität seiner selbst ohne
die Möglichkeit, das zu durchbrechen, empfindet.
Er will es empfindend,
genießerisch fühlend durchbrechen, und darin liegt auch schon das Problem. Verfolgen
wir an dieser Stelle nur eine grobe Entwicklungslinie der sogenannten Anthropozentrischen
Wende. Francis Bacon erhob das Experiment zur wissenschaftlichen Autorität und
gab so dem damaligen Menschen ein Instrument an die Hand, sich von geistlichen
Autoritäten zu lösen; Descartes sprach „Ich denke also bin ich’ und hievte die
menschliche Selbsterfahrung in den fragwürdigen Rang einer beweiskräftigen
Erfahrungstatsache; Immanuel Kant hat die Wirklichkeit als von der menschlichen
Wahrnehmung konstituiert beschrieben; Kierkegaard die lebengeschichtlich
erwirkte Subjekthaftigkeit; Schopenhauer und Nietzsche haben ein willentlich
herbeigeführtes Da-Sein beschworen; Freud, Heidegger und die Existenzialisten
sowie verschiedene Pioniere in den Humanwissenschaften und Künsten haben dann
eine professionalisierte und auf eine Weise abgreifbare Darstellung dieser
Konstitutivität auf den Weg gebracht. Und: das menschliche Individuum findet
sich seither herausgefordert, anhand eines professionalisierten Zugangs die
Optimierung seiner selbst zu erwirken. Die Egozentrik ist zu einer Art moralischen
Pflicht sich selber gegenüber geworden.
Aber keiner von den genannten
Wegbereitern hat tief genug geschürft. Auch der wohl tiefste von ihnen –
Kierkegaard – trug noch eine massive Positivierung und, gerade in der
Nachwirkung, eine problematische denkerische Händelung in einen Bereich hinein,
der unsere Intellektualität übersteigt. Jener ‚Bereich’, er beginnt spätestens
dort, wo wir das Lebensmaß veranschlagt haben und führt dann ins unergründlich
Intentionale. Doch das virtuelle Psycho-Instrumentarium, wie es zum neueren
Bildungskanon gehört, hat sich sukzessive in einen allzu praktischen, aber das
Eigentliche verfehlenden Werkzeugkasten der Lebenshändelung verwandelt.
Folgerichtig stagniert heute die Besprechung und Bearbeitung menschlicher Subjektivität
und Individualität. Und auch die gereift auftretenden Alt-68er kommen von ihrer
Denke in politisierter und psychologisierter Fertigbegrifflichkeit nicht mehr
weg.
Es gibt einen
Ausweg, und der ist immer möglich und er findet ja auch millionenfach jeden
Augenblick irgendwo bei irgendwem statt, nämlich den aufrichtigen Blick in
unser Inneres. Das muss von uns nicht erfunden werden, sowenig wie wir
Identität denken müssen (und können müssen.) Wer sich aber von der
denkerischen, wissenschaftlichen Seite annähern will, sollte sich von einem
Absolutismus der Quantifizierbarkeit alles Seienden gelöst haben. Eine
Konsistenz des Subjekthaften wird solches – und wenn auch im breitesten Sinne –
materialistisches Denken nie aufweisen können. Und wenn aus der Dekonstruktion
die Negation folgt, wie derzeit hingenommen in weiten Kreisen der Philosophie,
sollte man sich tatsächlich der Frage aussetzen, ob nicht die Dekonstruktion
unter Berufung auf umso weniger dekonstruierbare Vorzeichen, faktisch also mit
umso mehr verselbständigten Denkeinheiten erfolgt. Unser Begriff des Lebensmaßes
kann somit nur schwerlich auf einen wissenschaftlichen Status Quo des Diskurses
aufsetzen, sondern muss eine persönlich erlebte Freiheit - und dass wir uns
beim Identifizieren als immer schon Umgriffene erleben (können) - positiv
aufgreifen. Dieses in seiner Wirkung so unbedingt wie subtil erlebte Maß kann
auch nicht die in der postmodernen Intellektualität veranschlagte Leerstelle
ausfüllen, indem es Subjekthaftigkeit sei oder diese hervorbringe. Es ist
dieser konstitutiv nachgelagert so wie Identität – ein
Sein-durch-mit-sich-sein-Wollen – unserem originären Sein.
‚Konstitutiv
nachgelagert’ ?
(Das kann in diesem
kleinen Aufsatz nicht mehr verfolgt werden. Für einen Grundeindruck zu diesem
Thema sei etwa an die Ausführung „Intentionalität ~ Zeit – Raum“ verwiesen.)
Johann Stahuber, Stand 8.12.09